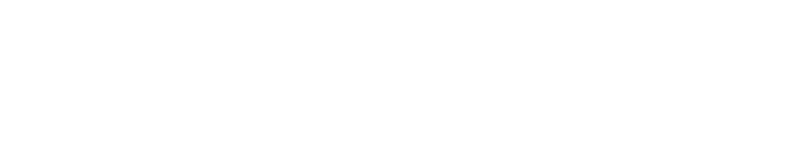Das Grünwalder Stadion: Mythos & Mauer
Das Stadion an der Grünwalder Straße 114, im Ursprung auch liebevoll „Sechzger“ genannt, ist weit mehr als nur eine Spielstätte – es ist Emotion, Erinnerung, Identität. Für viele Fans des TSV 1860 München ist es der letzte Ort, an dem sie sich dem Verein noch wirklich nahe fühlen können. Hier wehte einst der große Wind der Bundesliga, hier jubelten die Löwen in den 1960er Jahren über Meisterschaft und heiße Europapokalnächte. Namen wie Petar Radenković, Rudi Brunnenmeier, Timo Konietzka oder Fredi Heiß sind untrennbar mit dieser Adresse verbunden. Nach der Bundesliga-Rückkehr 1994 zogen die Löwen wenig später ins Olympiastadion und konnte damit eine Mannschaft finanzieren, die über Jahre zu den Top10 in Deutschland gehörte.
Nach dem Zwangsabstieg im Jahr 2017 kehrten die Löwen aus der modernen Allianz Arena ins Grünwalder zurück – viele empfanden das als Heimkehr, als Rückbesinnung auf die Wurzeln. Giesing wurde zum Symbol des Widerstands und der Romantik. Doch die Rückkehr war auch eine Zäsur: Mit ihr endete vorerst die Vision vom großen Fußball bei 1860.

Das Grünwalder Stadion ist für viele längst ein Symbol des Stillstands. Während der moderne Fußball in Arenen mit VIP-Logen, Business-Seats und Tiefgaragen spielt, steht Giesing wie eingefroren in der Vergangenheit. Die Kapazität von rund 15.000 Zuschauern – bei einem Traditionsverein wie 1860 – ist ein wirtschaftliches Nadelöhr, das ambitionierte Ziele in der 2. oder gar 1. Liga realitätsfern erscheinen lässt. Hinzu kommt die belastende Stadionmiete von 1,6 Millionen Euro jährlich. Dadurch hat 1860 einen deutlichen Wettbewerbsnachteil.
Und ausgerechnet die Helden von einst, die Legenden, die hier Geschichte schrieben – Petar „Radi“ Radenković oder Fredi Heiß – schütteln heute über das Grünwalder Stadion den Kopf. Sie lieben den Verein, aber sie wissen auch: Dieser Spielort ist zur Sackgasse geworden. Ein romantisiertes Relikt, das den Löwen die Flügel stutzt.
Hinzu kommen bauliche Grenzen, politische Blockaden und eine Stadion-Debatte, die den Verein seit Jahren lähmt. Die geplante Teilsanierung verspricht keine echte Lösung, sondern konserviert ein Problem: zu klein, zu alt, zu teuer im Verhältnis zum Ertrag.
Für die einen ist das Grünwalder Stadion ein Heiligtum, ein Rückzugsort in einer entfremdeten Fußballwelt. Für die anderen ist es eine Ruine – und Sinnbild dafür, warum der TSV 1860 München sportlich und strukturell auf der Stelle tritt.
Grünwalder Stadion
| Eigentümer | Stadt München |
| Standort | Grünwalder Straße 4, 81547 München |
| Stadtteil | Untergiesing |
| Baubeginn | 1911 |
| Eröffnung | 21. Mai 1911 |
| Kosten | 14.000 Mark (1911). Die letzte Renovierung kostete 2013 über 10,28 Millionen Euro |
| Erstes Spiel | 23. April 1911: TSV 1860 München - MTV 1879 4:0 |
| Kapazität | 15.000 |
| Rekordbesuch | 58.200 Zuschauer: 1860 - Nürnberg (14. März 1948, 2:1) |
| Architekten | Syrus Süss (1911), DEHALL und Tibet (1925/26), Rudolf Ortner (1958/59), Peter Biedermann und Wolfgang Böninger (1979). |
| Spielfläche | 105 x 68 Meter |
| Oberfläche | Beheizter Naturrasen |
| Einrichtung | Zwei Umkleidekabinen, Gastronomie- und VIP-Bereich, Presseraum, Ein zusätzlicher Umkleideraum für Schiedsrichter, weitere Behandlungsräumen für die medizinische Erstversorgung sowie zusätzliche Toilettenanlagen, auch für Menschen mit Behinderung. |
| Besonderheit | Das Grünwalder Stadion, indem die erste Mannschaft des TSV 1860 seit Juli 2017 wieder spielt, ist nach der Allianz Arena und dem Olympiastadion das drittgrößte Stadion Münchens. Die manuelle Anzeigetafel in der Westkurve ist noch heute der ganze Stolz. Der TSV 1860 teilt sich die Kultstätte mit dem FC Bayern. Das Stadion ist nur für Drittliga-, Damen- und Junioren-Fußball zugelassen. |